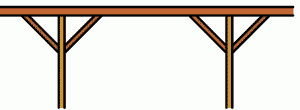Die
allgemeinen traditionellen
Holzverbindungen
Immer wenn zwei Hölzer
in der gleichen Höhenlage über Eck verbunden werden sollen benötigt man
Eckverbindungen. So findet man sie im Riegelbau und bei Holzfachwerken wenn zwei
Schwellen oder zwei Rähme sich an den Ecken treffen aber auch bei Dachstühlen
wenn sich Haupt- und Walmdachpfette im Gratbereich schneiden.
|
Alternative
|
Die
Hölzer könnten stumpf gestoßen werden und mit entsprechenden
Nagelblechen verbunden werden.
|
Gesichert wurden die Eckverbindungen früher
durch Holznägel und Klammern. Heute verwendet man Schraubenbolzen und Nägel.
Die unten angeführten Verbindungen findet man in verschiedensten abgewandelten
Formen. Die angegebenen Maße sind Richtmaße und hängen vom Anwendungszweck
ab.
Einteilung
| Allgemeines |
Gerade Blätter
sind verhältnismäßig einfach auszuarbeiten. Die Verbindungen werden
teilweise durch Schraubenbolzen gesichert werden. |
| Gerades
Eckblatt |
 |
Das gerade Blatt ist eine
einfache und sehr häufig verwendete Verbindung. Es bildet aber keine
Sicherung gegen das Verschieben der Hölzer. |
| Schräges
Eckblatt oder Druckblatt |
 |
Das schräge Eckblatt
bietet eine Sicherung gegen Verschiebung in beide Richtungen.
Allerdings muss dabei das aufliegende Holz gegen Abheben gesichert
sein. Daher kommt auch der zweite Name, denn diese Verbindung
funktioniert nur bei entsprechendem Druck von oben.
Achtung, die schräge Schnittfläche muss in die richtige Richtung
geneigt sein. |
| |
|
|
Scherblatt
oder
Schlitz und Zapfen |
 |
Das Scherblatt bietet eine
gewisse Sicherheit gegen das Verdrehen der Hölzer. Es wird häufig
bei der Sparrenverbindung am Firstpunkt (ohne Firstpfette) verwendet.
Nachteil: Wenn die Hölzer leicht verwunden sind, bringt diese
Verbindung Schwierigkeiten beim Aufstellen. |
| |
|
|
| Verdecktes
Eckblatt oder verdecktes Scherblatt |
 |
Beim verdeckten Scherblatt
wird das witterungsempfindlichere Hirnholz geschützt. Die Verbindung
ist aber arbeitsaufwändig. |
| |
|
|
| Eckzapfen
mit Gehrungsschnitt |
 |
Die Oberseite des
Eckzapfens mit Gehrungsschnitt ist optisch ansprechender. |
| |
|
|
Verdeckter
Gehrungszapfen |
 |
Beim verdeckten
Gehrungszapfen ist äußerlich nur der Gehrungsschnitt zu sehen.
Verwendet wird diese Verbindung zum Beispiel für Stiegengeländer. |
| |
|
|
Haken-
oder schwalbenschwanz=
förmiges Blatt |
 |
Das hakenförmige Blatt
bietet eine gewisse Sicherung bei Zugkräften. Allerdings ist die
Gefahr sehr groß, dass der Haken entlang der Faser abschert. |
| |
|
|
| Kammförmiges
Eckblatt |
 |
Das kammförmige Blatt ist
nur mehr selten zu finden. |
| |
|
|
Bei Kopfbandverbindungen
werden Versätze, Zapfen und Einblattungen verwendet. Sie verbinden Säulen mit
Pfetten bzw. Rahmenhölzer.
Ausbildung und
Anordnung der Kopfbänder:
Üblicherweise sind Kopfbänder etwas schwächer (schmäler) als die
Säulen.
Querschnittsabmessungen: 8/10 bis ca. 12/14cm.
Normalerweise sind sie unter 45°, manchmal auch steiler angeordnet. Je größer
das entstehende Dreieck ist, umso wirkungsvoller werden die Kopfbänder.
Kopfbänder mit Zapfenverbindungen und Versätze können mittig zu den Säulen
angeordnet werden. Statisch wäre es günstig, wenn die Kopfbänder an
Hausaußenseite bündig zur Stuhlsäule sitzen würde ( - dort liegen auch die
Sparren auf).
Aufgabe der Kopfbänder
(Bug):
|
Alternative
|
Unverschiebliche
Dreiecke mittels genagelte oder geschraubte seitliche Laschen.
|
Gesichert wurden die Kopfbänder
früher durch Holznägel. Heute verwendet man Schraubenbolzen oder Schrauben.
Die unten angeführten Verbindungen findet man in verschiedensten
abgewandelten Formen.
Einteilung
|
Traditionelle
Längsverbindungen
|
Man findet traditionelle Holzverbindungen bei
älteren Holzkonstruktionen.
Zwischenzeitlich wurden die traditionellen Längsverbindungen durch
ingenieurmäßige Verbindungen (mit Knotenblechen, vorgefertigten
Verbindungselementen, ...) fast zur Gänze abgelöst. Derzeit werden sie aber
wieder verstärkt verwendet.
|
Vorteile
|
Traditionelle
Holzverbindungen wirken optisch und zeigen richtig angewandt den
Kräfteverlauf in den Konstruktionen.
|
|
|
Häufig
ergeben sich Vorteile beim Aufstellen der Holzkonstruktionen.
|
|
Nachteile
|
Hoher
Arbeitsaufwand bei händischer Ausarbeitung der Verbindungen. Durch die
Verwendung von Abbundanlagen können traditionelle Holzverbindungen aber
wieder rationell und mit hoher Passgenauigkeit hergestellt werden.
|
|
|
Teilweise
sind größere Holzdimensionen erforderlich.
|
Gesichert wurden die Verbindungen früher durch
Holznägel und Klammern. Heute verwendet man Schraubenbolzen und Nägel.
Die unten angeführten Verbindungen findet man in verschiedensten abgewandelten
und kombinierten Formen. Die angegebenen Maße sind Richtmaße und hängen stark
vom Anwendungszweck ab.
Einteilung
Gerade Blätter
| Allgemeines |
Gerade Blätter
sind verhältnismäßig einfach auszuarbeiten. Die Verbindungen werden
durch zwei diagonal angeordnete Schraubenbolzen gesichert werden. |
| Gerades
Blatt |
 |
Das gerade Blatt ist eine
einfache und sehr häufig verwendete Verbindung. |
| Gerades
Blatt mit schrägem Schnitt |
 |
Durch den 30° geneigten
Schnitt verspreitzen sich die Hölzer besser und es können leichte
Biegebeanspruchungen übernommen werden. |
|
|
| Gerades
Blatt mit Gratschnitt |
 |
Der auf beiden Seiten
eingeschnittene Grat bringt eine Sicherung bei
Horizontalbeanspruchungen. |
|
|
| Gerades
Blatt mit schrägem Schnitt und Gratschnitt |
 |
Diese Verbindung kombiniert
die Vorteile des schrägen Schnittes und des Gratschnittes. Die
Hölzer sind in beide Richtungen gehalten. |
|
|
| Gerades
Blatt mit Zapfen |
 |
Der Zapfen bringt eine
horizontale Sicherung gegen gegenseitiges Verschieben der Hölzer. Mit
verkürztem Blatt wird diese Verbindung bei Stößen von Mittelpfetten
über Stuhlsäulen verwendet. |
|
|
| Gerades,
schwalbenschwanzförmiges Blatt mit Brust |
 |
Durch den Schwalbenschwanz
ist zusätzlich zur horizontalen Sicherung eine geringe Beanspruchung
auf Zug möglich. |
|
|
Schräge Blätter
| Allgemeines |
Schräge
Blätter werden hauptsächlich verwendet um Querkräfte zu
übertragen. Das bedeutet ein Holz liegt mit hoher Last auf dem
anderen auf. Bei der Verwendung von geraden Blättern würde ein Holz
am Blattansatz aufreißen.
Typische Verwendung: Der Gerberstoß |
| Schräges
Blatt |
 |
Manche Statiker drehen die
Verbindung um. Um des Verkanten der Hölzer zu verhindern werden dann
die Querkräfte mit Schraubenbolzen auf das obere Holz hinaufgehängt.
Eine entsprechende Anwendung finden Sie bei diesem Satteldach |
|
|
| Schräges
Blatt mit schrägem Schnitt |
 |
Durch den schrägen Schnitt
entsteht wieder eine Verkeilung der Hölzer. Beim Gerberstoß ist eine
solcher Verkeilung allerdings nicht erwünscht. Es sollte sich ein
Gelenk ausbilden über das keine Biegung übertragen wird. |
|
|
Hakenblätter
| Allgemeines |
Hakenblätter
können kleinere Zugkräfte übertragen.
Sie werden mit oder ohne Doppelkeile ausgeführt. Mit den Keilen kann
die Verbindung kraftschlüssig nachgespannt werden und es werden
dadurch kleinere Ungenauigkeiten bei der Ausarbeitung
ausgeglichen. |
| Gerades
Hakenblatt |
 |
Das gerade Hakenblatt wurde
hauptsächlich zum Übertragen größerer Zugkräfte verwendet. Da der
Holzquerschnitt stark geschwächt wird, wird diese Verbindung kaum
mehr verwendet. |
|
|
| Schräges
Hakenblatt |
 |
Das schräge Hakenblatt
kann im Gegensatz zum geraden Hakenblatt auch zur Übertragung von
größeren Querkräften verwendet werden. |
|
|
| Verdecktes
Hakenblatt |
 |
Das verborgene oder
verdeckte Hakenblatt ist eine seltene Sonderform. Hier werden keine
Keile verwendet.
Eine waagrechte, dreieckige Fläche bildet den Haken. |
|
|
Stoß mit Zapfen
| Schlitz
und Zapfen |
 |
Der Zapfen bringt nur eine
Sicherung gegen horizontales Verschieben. Deswegen wird häufig diese
Verbindung mit dem geraden Blatt kombiniert. (Siehe Gerades Blatt mit
Zapfen.) |
|
|
Gerader Stoß
| Stumpfer
Stoß mit Laschen |
 |
Die Dimensionierung der
Laschen und die Wahl der Verbindungsmittel hängt von der Art der
Beanspruchung ab. Es können relativ große Kräfte übertragen
werden.
Die seitlich oder manchmal auch oben und unten aufgesetzten Laschen
vergrößern den Querschnitt und wirken optisch nicht sehr schön. |
|
|
| Gerader
Stoß mit eingesetztem Stück |
 |
Verbindungen mit
eingesetztem Stück wurden in verschiedensten Varianten ausgeführt.
Mit geraden Stücken, mit schrägen Schnitten und mit verschiedenen
Hakenvarianten. |
|
|
Die Sparrenkerbe (Kerve,
Ferserl)
Sie ist die häufigste Verbindung bei Dachstühlen. Dabei verbindet die
Sparrenkerbe die in der Dachneigung liegenden Sparren mit den meist waagrecht
liegenden Pfetten.
Bei Pfettendächern muss die Sparrenkerbe neben den Vertikal- und
Horizontallasten noch Aufgaben bei der Queraussteifung der Dachstühle
übernehmen.
Bei Sparrendächern entstehen aus der Dreieckskonstruktion Sparren -
Sparren -Decke erhebliche Druckkräfte in der Sparrenlängsrichtung. Deshalb
darf dabei die einfache Sparrenkerbe ohne Zusatzmaßnahmen nicht ausgeführt
werden.
Bei kleineren Spannweiten kann das Wiener Kastl verwendet werden.
Die Verbindung beim
First
Bei einer Firstpfette wird der Sparren entlang dem Senkelriss abgeschnitten.
Dabei sollte zwischen den Sparren etwas Luft bleiben (damit die Sparren auf der
Firstpfette satt aufliegen).
Ohne Firstpfette wird dar Scherzapfen oder auch ein einfaches Blatt verwendet.
|
Alternative
zur Sparrenkerbe
|
Aufgenagelte
Bretter bzw. Pfostenstücke die der Dachneigung entsprechend geschnitten
werden müssen.
|
Gesichert wurden die Sparren durch entsprechende
Sparrennägel. In Sonderfällen, bei besonderen Beanspruchungen werden auch
Stahlwinkel verwendet.
Einteilung
| Sparrenkerbe |
 |
Diese Sparrenkerben werden
bei allen Pfettendächern angewendet. Die Kerbentiefe beträgt 1/3 bis
1/6 der Sparrenhöhe. Im Alpenbereich wird bei normalen Vordächern
1/6 verwendet, da sonst der Sparren zu stark geschwächt wird.
Zum Ausarbeiten der Kerben eignet sich besonders die Kreissäge oder
spezielle Kerbenfräsen. Dabei werden gleich mehrere Sparren
gemeinsam bearbeitet.
Das lotrechte Obholz ist für die Zimmerer eine wichtige Größe, denn
als Basisfläche dient die plane Dachfläche. |
| Wiener
Kastl |
 |
Das Wiener Kastl (In
Salzburg auch Gaissfuß genannt) bietet eine bessere Verbindung als
die Sparrenkerbe. Längskräfte im Sparren bewirken kein
Herausrutschen, sondern werden senkrecht zur Pfettenfaser
(=Schwachstelle) übertragen.
Nachteil: Nicht nur der Sparren sondern auch die Mauerbank (Fußpfette)
muss bearbeitet werden.
Wegen des hohen Arbeitsaufwandes,wird das Wiener Kastl nur mehr selten
ausgeführt.
Als Vereinfachung könnte die Pfette durchgehend ausgenommen werden. |
| |
|
|
Verkämmungen zählt man
auch zur großen Gruppe der Verknüpfungen.
Sie werden verwendet wenn sich 2 in unterschiedlicher Ebene befindliche Hölzer
schneiden und die Hölzer so miteinander verbunden werden sollen, dass sie sich
nicht verschieben können.
Im Kreuzungspunkt beider Hölzer wird ein gegenseitiger, passgenauer Ausschnitt
angefertigt. Die Tiefe dieser Ausschnitte hängt von der jeweiligen Anwendung
ab, sollte aber mindestens 2cm betragen.
|
Alternative
|
Die
Hölzer könnten übereinander gelegt werden und mit entsprechenden
Nagelblechen oder Dübeln und Schraubenbolzen verbunden werden.
|
Gesichert wurden die Verkämmungen früher durch
Holznägel. Heute verwendet man Schraubenbolzen und Nägel.
Die unten angeführten Verbindungen findet man in verschiedensten abgewandelten
Formen. Die angegebenen Maße sind Richtmaße und hängen vom Anwendungszweck
ab.
Einteilung
Versätze werden auch
heute noch sehr häufig angewendet. Sie dienen zur Übertragung von
Druckkräften bei Streben und Kopfbändern. Versätze eignen sich
besonders für Anschlüsse ab ca. 25°.
Die Kraftübertragung von Hirnholz auf Hirnholz ist besonders gut. Deswegen muss
für den Einschnitt die Winkelhalbierende gebildet werden.
Die Vorholzlänge:
Eigentlich versteht man unter der Vorholzlänge die Länge zwischen Balkenende
und Strebenansatz. Für die Berechnung bzw. die Tragfähigkeit ist jedoch die
rechnerische Vorholzlänge entscheidend. Deswegen ist sie auch in den
Zeichnungen eingetragen.
Holz kann entlang der
Faser relativ leicht gespalten (abgeschert) werden. Die Druckkräfte werden
hauptsächlich über die Hirnholzflächen eingeleitet. Da diese Flächen
auf Druck 8 bis 10 mal mehr aushalten als Holz auf Abscherung ergibt sich die
Formel: Vorholzlänge = 8 x Versatztiefe t.
Zapfen können bei allen Versätzen mit verwendet werden. Sie haben aber nur
konstruktive Aufgaben.
|
Alternative
|
Die
Hölzer könnten mittels aufgesetzten Laschen und Knaggen druckfest
verbunden werden. Oder man verwendet vorgefertigte Balkenschuhe aus
Stahl.
|
Gesichert wurden die Versätze früher durch
Klammern und Holznägel. Heute verwendet man Schraubenbolzen oder seitliche
Laschen.
Die unten angeführten Verbindungen findet man in verschiedensten abgewandelten
Formen.
Einteilung
Einfacher
und doppelter Versatz
Anwendungen: Strebenanschluss bei abgestrebten Pfettendächern,
Sprengwerk- und Hängewerkskonstruktionen, Fachwerksbindern,
Aussteifungsstreben im Fachwerksbau, besonders druckfester Anschluss
von Kopfbändern mit Pfetten und Stuhlsäulen, ........ |
| Einfacher
Versatz |
 |
Der Einfache Versatz ist
eine häufig verwendete Verbindung.
Der größte Teil der Strebenkraft wird über die in der
Winkelhalbierenden eingeschnittene Hirnholzfläche übertragen. |
| Einfacher
Versatz mit Zapfen |
 |
Zapfen dienen als Hilfe
beim Aufstellen der Konstruktionen. Sie werden aber statisch nicht
berücksichtigt.
Zapfenbreite: 1/3 der Holzbreite bzw. Stemmkettenbreite.
Nachteile: Zusätzlicher Aufwand beim Ausarbeiten und wenn die
Konstruktion im Freien ist, könnte sich im Zapfenloch Wasser
ansammeln und so zu vorzeitigen Schäden führen. |
| |
|
|
| Doppelter
Versatz |
 |
Der doppelte Versatz kann
besonders große Druckkräfte aufnehmen. Er ist aber zum Ausarbeiten
schwierig, da beide Versatzstücke sehr passgenau gearbeitet werden
müssen.
Möglichkeit: Beim hinteren Versatzteil Luft lassen und nach dem
Zusammenbau mittels Stahlbleche die Kraftschlüssigkeit wieder
herstellen. |
| |
|
|
|
Sonderform
Fersenversatz
|
| Fersenversatz |
 |
Der Fersenversatz hat den
großen Vorteil, dass die Vorholzlänge leichter einzuhalten ist.
Nachteil: Die Strebenkraft ist exzentrisch in der Strebe und
verursacht dadurch eine Biegebanspruchung.
In der ÖNORM ist diese Verbindung nicht mehr vorgesehen.
Berechnung der zulässigen Kräfte nach DIN http://www.statikweb.de
Anwendung: Bei geringer bzw. keiner Vorholzlänge, konstruktiv bei
Brettertüre, ..... |
| |
|
|
Zapfenverbindungen
gehören zur großen Gruppe der Verknüpfungen. In der Regel liegen beide
Hölzer in der gleichen Ebene und stehen senkrecht (90°) zueinander. Ausnahme:
Schräge Zapfen.
In einem Holz wird das Zapfenloch ausgenommen und im anderen Holz der Zapfen
ausgearbeitet.
Zapfenausbildung
Die Zapfenbreite beträgt als Richtwert 1/3 der Breite des einzuzapfenden
Holzes. In der Praxis verwendet man aber die gängigen Breiten der
Stemmkettenmaschine.
An den Enden sollte der Zapfen leicht angefast (abgeschrägt) werden. Dadurch
wird der Einbau erleichtert.
Als Zapfenlänge kann entweder 1/3 des Höhe des Holzes mit dem Zapfenloch
angenommen werden oder 4 - 5,5cm verwendet werden. Wird der Zapfen durch einen
Nagel gesichert, so sollte der Zapfen ca. 7cm lang sein. Solche Nägel sind nahe
des Zapfenansatzes einzubauen, da sie sonst leicht ausreißen.
Zapfenloch:
Das Zapfenloch ist 5 bis 10mm tiefer auszuarbeiten als die Zapfenlänge ist. Es
dürfen keine Lasten über die Stirnfläche des Zapfens übertragen werden.
Vorteile:
Durch den Zapfen werden die einzuzapfenden Hölzer in zwei Richtungen gesichert.
Es ergeben sich Vereinfachungen beim Aufstellen der Konstruktionen.
Nachteile:
Durch den Zapfen geht relativ viel Fläche für die Kraftübertragung verloren.
In Zapfenlöchern kann sich Wasser sammeln und damit wird die Fäulnis
begünstigt. - Im Freien nur nach unten schauende Zapfenlöcher
verwenden.
|
Alternative
|
Die
Hölzer könnten stumpf gestoßen werden und mit entsprechenden Laschen,
Nagelblechen oder Knotenblechen verbunden werden.
|
Die einzelnen Verbindungen können mit Nagel
gesichert ( - längerer Zapfen) oder auch ohne ausgeführt werden.
Einteilung
| Allgemeines |
Zapfenverbindungen
werden häufig für Druckverbindungen verwendet.
Beispiele: Pfette - Stuhlsäule - Schwelle. Oder im Riegelbau die
Anschlüsse zwischen Kopfschwelle (Rähm) und Säule, Säule und
Fußschwelle. |
| Gerader
einfacher Führungszapfen |
 |
Der gerade Zapfen
gehört auch heute zu den häufig verwendeten Verbindungen. Das
Zapfenloch ist an den Seiten immer etwas zu erkennen. |
Zurückgesetzter-
Zapfen |
 |
Der zurückgesetzte Zapfen
ist optisch schöner. Das Zapfenloch ist dabei nicht sichtbar.
Ein Zapfen in einer Schwelle ist etwas geschützter gegen das
Eindringen von Wasser. |
| |
|
|
| Geächselter
oder abgesetzter Zapfen |
 |
Dieser Zapfen wird bei
Wandecken oder bei Stuhlsäulen mit endenden Pfetten verwendet. |
| |
|
|
| Schräger
Zapfen |
 |
Der schräge Zapfen wird
häufig für Kopfbänder verwendet. Das Zapfenloch kann zur
Vereinfachung gleichmäßig, rechteckig ausgenommen werden.
Zur Übertragung von Druckkräften sind hier Versätze besser
geeignet. |
| |
|
|
| Schräger
Zapfen mit Nagel |
 |
Der gleiche schräge Zapfen
wie oberhalb, nur verlängert damit der Holznagel genügend Halt
findet. |
| |
|
|
| Kreuzzapfen |
 |
Der Kreuzzapfen ist eine
besonders Verwindungssteife Verbindung. |
| |
|
|
| Einfacher
Blattzapfen |
 |
Der Blattzapfen gibt
zusätzlichen seitlichen Halt. Gesichert werden die Blattzapfen durch
Schraubenbolzen. |
| |
|
|
| Doppelter
Blattzapfen |
 |
Beim doppelten Blattzapfen
ist eine besonders breite Säule erforderlich. |
|
|
|
Schwalbenschwanz=
förmiger Zapfen |
 |
Zapfenverbindungen können
keine Zugkräfte übernehmen. Beim schwalbenschwanzförmigen Zapfen
wird durch den schräg eingeschnittenen Zapfen und die dazugehörige
Sicherung mit Doppelkeilen versucht doch geringe Zugkräfte zu
übertragen. Die Keile müssen dann noch mit einem Nagel gegen Lockern
gesichert werden. |
| |
|
|
| Riegelzapfen |
 |
Der Riegelzapfen ist eine
häufige Verbindung im Fachwerksbau und Riegelbau.
Damit werden Brüstungs- und Sturzriegel an Säulen angeschlossen. |
| |
|
|
| Brustzapfen
und der schräger Schnitt mit Zapfen siehe Einblattungen und
Auswechslungen |